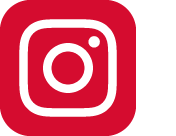›Ich bin ein politisch Gefangener.‹ Genau diese Selbstintroduktion wurde für mich zur Schlüsselstelle. Eine klare Aussage. Was, so folgerte ich unverzüglich aus der gegebenen Auskunft, bedeutet diese Extremsituation heute; in unserer unmittelbaren Gegenwart, in der wir ohne Unterlass und immer drastischer davon hören, was mit oppositionellen Intellektuellen auf dieser Welt geschieht, welchen drakonischen Torturen sie ausgesetzt werden, wie man versucht, sie zum Schweigen zu bringen, wie man sie in den Gefängnissen verschwinden lässt, sie ausschaltet. Die gegenwärtige Virulenz solcher schon überwunden geglaubter Praktiken ist offensichtlich.
Die Musik zu Beginn der Oper, worin die zentralen Themen des Werkes anklingen, gibt uns die Gelegenheit, in einigen Momenten die Vorgeschichte der Figur zu erzählen. Wenn man das gestaltet und dabei die Verhaftung des nonkonformistischen Journalisten selbst ins Bild rückt, lernen wir ihn bereits kennen. Der Blick auf seinen Weg durch die Schrecken des Lagers wird von nun an bestimmend. Wir begleiten ihn gleichsam auf der qualvollen Reise durch diese Schattenwelt und die Assoziation zu Dantes Inferno stellt sich unverzüglich ein. ›Ihr, die ihr hier eintretet, lasst alle Hoffnung fahren.‹ Wie Orpheus steigt Janáček hinab in jenes Inferno und blickt ins Haus der lebenden Toten, deren Stimmen er in je individueller Tonsprache festhält. Hier herrschen Willkür und Recht, Chaos und Ordnung, Gewalt und Zärtlichkeit. Wer ist Opfer, wer Täter? Janáček gibt allen eine Stimme: Sie singen um ihr Leben, finden einen Klangraum in diesem Requiem für die Vergessenen.
Alexandr Petrovic Gorjančikov verharrt ohne Unterbrechung in allen Szenen auf der Bühne, agiert als unser Führer durch diese Unterwelt, die ebenso unsere Gegenwart bezeichnet. Wir verlieren ihn am gesamten Abend nicht aus den Augen. Das bedeutet zugleich, dass die oft sehr umfangreich geratenen Monologe der anderen Gefangenen einen Adressaten haben, einen Fluchtpunkt, der sie dazu bringt, über ihr Schicksal zu berichten. Wie durch eine exorzistische Prozedur aktiviert, gelangen die Monologe zum Ausdruck, werden befreit aus dem Gefängnis des eigenen Erinnerungsraums.«
Auszug aus dem Programmheft zu Aus einem Totenhaus